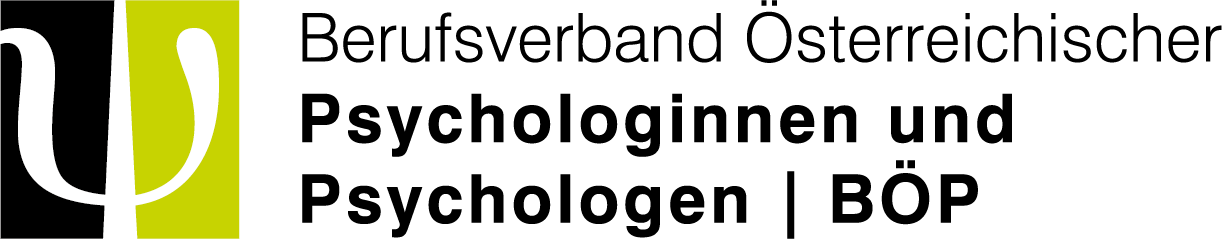Klinische Psycholog:innen. Die Expert:innen für mentale Gesundheit
Klinische Psycholog:innen behandeln Menschen jeden Alters und sind Spezialist:innen für alle psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Ängste, Burnout etc. Sie diagnostizieren, beraten und behandeln/therapieren. In Österreich gibt es derzeit knapp 12.000 Klinische Psycholog:innen. Auf dieser Seite haben wir die wichtigsten Fakten rund um Klinische Psycholog:innen zusammengefasst.

Klinische Psycholog:innen – wer sie sind, wie sie arbeiten
Was machen Klinische Psycholog:innen?
Klinische Psycholog:innen behandeln/therapieren, beraten und begleiten Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Ängsten, Depressionen, Psychosen, Schlafstörungen, Burnout etc., ebenso wie solche mit psychischen Belastungen im Zusammenhang mit körperlichen Erkrankungen wie z.B. Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, rheumatischen Erkrankungen etc. Außerdem sind sie Expert:innen für klinisch-psychologische Diagnostik, die sich mit der Erkennung, Abklärung und Einordnung psychischer Auffälligkeiten, Belastungen und Störungen befasst und dazu dient spezifische Fragestellungen zu beantworten.
Klinische Psycholog:innen bieten Einzel-, Paar-, Gruppen und Familiensettings an, arbeiten in freier Praxis, Spitälern, Gesundheitseinrichtungen oder anderen Institutionen.
Klinische Psycholog:innen arbeiten mit wissenschaftlich fundierten klinisch-psychologischen Methoden, die individuell auf jede/n Klient:in und jedes Störungsbild angepasst werden.
Aspekte wie Ausbildung, Tätigkeitsfelder oder Fortbildungen von Klinischen Psycholog:innen regelt das Psychologengesetz 2013.
Wie werden Klinische Psycholog:innen ausgebildet?
Klinische Psycholog:innen absolvieren eine mehrstufige, umfassende Ausbildung, die wissenschaftliche, theoretische und praktische Komponenten vereint. Voraussetzung für die postgraduelle Ausbildung ist ein abgeschlossenes Studium der Psychologie im Umfang von mindestens 300 ECTS (Bachelor + Master) oder ein gleichwertiger akademischer Abschluss des Studiums der Psychologie gemäß § 4 Abs 2 Psychologengesetz 2013. Erst bei Erfüllung dieser Voraussetzungen und noch weiteren Aufnahmekriterien darf die klinisch-psychologische Fachausbildung, die eine vertiefte theoretische und praktische Befähigung zur Ausübung klinisch-psychologischer Tätigkeiten vermittelt, begonnen werden. Die klinisch-psychologische Fachausbildung umfasst theoretische Grund- und Aufbaumodule, ein Erwerb von fachspezifischen praktischen Stunden (Gesamtumfang von mind. 2098 Stunden) sowie Supervisions- und Selbsterfahrungsstunden (mind. 196 Stunden). Nach Abschluss der Ausbildung, in der Kenntnisse über Theorie, Methodik und Praxis der Klinischen Psychologie, einschließlich klinisch-psychologischer Diagnostik, Befundung und Begutachtung, Behandlung/Therapie, Krisenintervention, Beratung und Coaching, Rehabilitation und Gesundheitsförderung u.v.m. erworben wird und der Absolvierung einer kommissionellen Prüfung, kann ein Antrag auf Eintragung in die Berufsliste der Klinischen Psycholog:innen des Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gestellt werden. Im Rahmen dieser klinisch-psychologischen Fachausbildung können anschließend bzw. parallel dazu weitere Zusatzqualifikationen bzw. Vertiefungen und zertifizierte Weiterbildungen für individuelle Schwerpunktsetzungen in vielen Bereichen (z.B. bezüglich spezifischer Altersgruppen, Erkrankungen und Störungen oder Interventionsmethoden) absolviert werden. Ebenso besteht die Möglichkeit weiterführende diagnostische Kompetenzen, wie z.B. in Kinder-, Jugend-, und Familienpsychologie, Rechtspsychologie, Forensische Psychologie, Waffenpsychologie, Verkehrspsychologie etc. zu erwerben.
Wie behandeln/therapieren Klinische Psycholog:innen psychische Erkrankungen und psychische Probleme und Belastungen bei organischen Erkrankungen?
Klinische Psycholog:innen setzen ihre Behandlung maßgeschneidert an der jeweiligen Störung bzw. den damit verbundenen Beschwerden und dem vereinbarten Behandlungsziel an, arbeiten methoden- und schulenübergreifend, evidenzbasiert nach wissenschaftlichen Standards und stützen ihr Vorgehen auf sorgfältige diagnostische Untersuchungen und wissenschaftlich evaluierte Methoden, wie z.B.:
- Wissensvermittlung und Psychoedukation
- Achtsamkeit & Entspannung
- Kognitive Umstrukturierung
- Training sozialer & emotionaler Kompetenzen
- Ressourcenaktivierung und Resilienz
- Übungen im Alltag & Hausaufgaben
- Spezielle Programme bei: Depression, Angst, Zwang, Trauma, ADHS, Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie, Sucht u. v. m.
Was macht klinisch-psychologische Behandlungen so besonders?
Das Besondere bei klinisch-psychologischen Behandlungen ist, dass eine Vielzahl an wissenschaftlich abgesicherten psychologischen Interventionsmethoden, die störungsbezogen, ressourcenorientiert und transdiagnostisch sein können, je nach Anliegen und individueller Situation eingesetzt werden.
Klinische Psycholog:innen nutzen somit ein großes Repertoire an Behandlungsmethoden und sind nicht an eine bestimmte „Schule“ oder Entstehungslehre gebunden. Je nach Problemlage und Anliegen wählen sie das passende Werkzeug und können dadurch Klient:innen individuell helfen. Durch diesen eklektischen Ansatz ist eine auf den Einzelfall hin personalisierte, maßgeschneiderte und bestmögliche Intervention gewährleistet.
Wie diagnostizieren Klinische Psycholog:innen psychische Erkrankungen und belastende psychische Zustände?
Klinisch-psychologische Diagnostik und die darauf aufbauende Erstellung von Befunden, Zeugnissen und Gutachten ist eine nach dem Psychologengesetz 2013 Klinischen PsychologInnen vorbehaltene Tätigkeit. Untersucht werden dabei unter anderem psychische Störungen und Leidenszustände und die Bestimmung ihrer Krankheitswertigkeit, psychische Leistungen/Leistungsfähigkeit, Persönlichkeit/Persönlichkeitsmerkmale inkl. Persönlichkeitsstile und -störungen, Partnerschafts- und familiäre Probleme, Entwicklungsstörungen, Stress-, Belastungs- und Trauma- und Belastungsstörungen bei allen Altersgruppen und Lebenslagen. In einem mehrstufigen wissenschaftlich fundierten Verfahren wird das Verhalten, Erleben, psychische Funktionsweisen und der allgemeine psychische Zustand systematisch erfasst, exploriert und eingeordnet. Dafür führen Klinische Psycholog:innen diagnostische Gespräche, auch Anamnesegespräche genannt, setzen standardisierte, wissenschaftlich geprüfte Testverfahren ein, beobachten und protokollieren systematisch Verhalten und Symptome und integrieren alle erhobenen Daten aus Gesprächen, Tests, Beobachtungen zu einem Gesamtbild, das in einem psychologischen Befund final schriftlich festgehalten wird. Dies kann im Einzel- oder/und im Familiensetting durchgeführt werden. Je nach Fragestellung wird auch eine psychologische Diagnose (orientiert an den internationalen Diagnosesystemen ICD10/ICD11) gegeben.
Klinisch-psychologische Diagnostik kann bei Vertragspsycholog:innen direkt mit den Krankenkassen verrechnet werden. Wird die Diagnostik von Wahlpsycholog:innen durchgeführt, kann ein Teil der Kosten von den Krankenkassen refundiert werden.
Namen von Vertrags- und Wahlpsycholog:innen sind u.a. bei der Österreichischen Gesundheitskasse und den jeweiligen Landesstellen sowie auf dem Informationsportal psychnet.at des Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) zu finden. Weitere Information finden Sie auch unter Klinisch-psychologische Diagnostik · BÖP oder durch Kontaktaufnahme zur Helpline 01/504 8000 · BÖP.
Wie beraten und begleiten Klinische Psycholog:innen?
Klinische Psycholog:innen beraten und begleiten, indem sie Menschen in psychischen Belastungs-, Konflikt- oder Krankheitssituationen unterstützen. Sie führen zum Beispiel klinisch-psychologische Beratung in Bezug auf verschiedene Aspekte gesundheitlicher Beeinträchtigungen, ihrer Bedingungen und Veränderungsmöglichkeiten sowie Einzelgespräche zur emotionalen Entlastung, Entscheidungsfindung, Zielerreichung, Problemlösung, Psychoedukation zu Stressbewältigung, Emotionsregulation und Entspannung etc. Klinische Psycholog:innen können als beratende Instanz Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, dabei helfen Klarheit zu gewinnen, Selbstwirksamkeit zu stärken und sie können auch während einer längeren krisenreichen Lebensphase oder bei vielen Veränderungen als Stütze fungieren.
Wo arbeiten Klinische Psycholog:innen und wo finde ich diese?
Klinische Psycholog:innen arbeiten in vielen unterschiedlichen Bereichen. Man findet sie in Krankenhäusern und Ambulanzen, in freien Praxen oder Gemeinschaftspraxen, in Rehazentren, aber auch in Schulen und Bildungseinrichtungen, in der Forensik und Justiz oder in der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie in Universitäten und Forschungseinrichtungen.
Auf welchen Grundlagen basiert klinisch-psychologische Behandlung?
Klinisch-psychologische Behandlung basiert auf den Grundlagen der naturwissenschaftlichen Psychologie und ihrer anwendungsnahen Teilgebiete wie Klinische Psychologie, Gesundheitspsychologie, Biologische Psychologie, Diagnostische und Differentielle Psychologie, Sozialpsychologie, Neuropsychologie, Psychologische Interventionslehre etc. Dabei wird eng mit der ebenfalls naturwissenschaftlich geprägten Medizin zusammengearbeitet, insbesondere mit den verschiedenen klinischen Disziplinen der Medizin (z. B. Innere Medizin, Kardiologie, Immunologie, Psychiatrie, Neurologie). Grundlegend damit verbunden sind die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geprägten Konzepte von Gesundheit und Krankheit/Störung und das so genannte bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit und Krankheit. Dabei orientiert man sich an der „International Statistical Classification of Diseases and related Health Problems“ (ICD) der WHO. Diese enthält Codes für Krankheiten, Anzeichen und Symptome, auffällige Befunde, Beschwerden, soziale Umstände und äußere Ursachen von Verletzungen oder Krankheiten.
Wie viele Klinische Psycholog:innen gibt es in Österreich?
Österreichweit gibt es derzeit knapp 12.000 Klinische Psycholog:innen. Alle Klinische Psycholog:innen in Österreich sind in die Liste der Klinische Psycholog:innen des Gesundheitsministeriums eingetragen. Diese Liste finden Sie hier: https://klinischepsychologie.ehealth.gv.at/
Welche Ausbildung haben Klinische Psycholog:innen?
Klinische Psycholog:innen verfügen über ein abgeschlossenes Psychologiestudium im Ausmaß von mindestens 300 ECTS (Bachelor + Master) oder ein gleichwertiger akademischer Abschluss des Studiums der Psychologie gemäß § 4 Abs 2 Psychologengesetz 2013. Darauf aufbauend absolvieren sie eine postgraduelle Fachausbildung mit Theorie und Praxisteil. Nach Abschluss ihrer Ausbildung müssen sich Klinische Psycholog:innen regelmäßig und fortlaufend fortbilden. Einige Klinische Psycholog:innen haben zusätzliche Spezialisierungen, beispielsweise in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie, Schmerzpsychologie oder Notfallpsychologie.
Alles dasselbe? Nein! – Klinische Psycholog:innen und andere Berufsgruppen
Sind Psycholog:innen und Klinische Psycholog:innen das gleiche?
Psycholog:innen sind Personen, die ein Diplom oder Masterstudium der Psychologie mit 300 ECTS erfolgreich abgeschlossen haben.
Klinische Psycholog:innen haben darüber hinaus eine umfangreiche theoretische und praktische Fachausbildung absolviert. Im Gegensatz zu Psycholog:innen dürfen nur Klinische Psycholog:innen Menschen mit psychischen Erkrankungen behandeln/therapieren, beraten oder psychische Erkrankungen diagnostizieren.
Was ist der Unterschied zu Psycholog:innen, Psychotherapeut:innen und Psychiater:innen?
Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist die Berufsbezeichnung „Psycholog:in“ in Österreich gesetzlich geschützt. In Österreich darf sich als Psycholog:in bezeichnen, wer ein Studium der Psychologie im Ausmaß von mindestens 300 ECTS Punkten (Mast- oder Diplomstudium) erfolgreich abgeschlossen hat. Alle Psycholog:innen haben also mindestens fünf Jahre erfolgreich an einer Universität studiert.
Für jene Arbeitsbereiche der Psychologie, welche die Gesundheit betreffen, ist neben dem Psychologiestudium eine Ausbildung in Klinischer Psychologie und/ oder Gesundheitspsychologie erforderlich. Die Ausbildung in Klinischer Psychologie umfasst mindestens 2.500 Stunden, jene der Gesundheitspsychologie mindestens 2.000 Stunden.
Psychotherapeut:innen diagnostizieren und behandeln wie auch Klinische Psycholog:innen psychische Erkrankungen – sie spezialisieren sich dabei jedoch auf eine bestimmte psychotherapeutische Methode (z. B. die Verhaltenstherapie). Arbeitsgebiete sind die psychotherapeutische Begutachtung, Hilfsstellung in Lebenskrisen, Änderung gestörter Verhaltensweisen und Einstellungen, Förderung der Reifung etc.
Psychiater:innen absolvieren ein zumindest sechsjähriges Medizinstudium mit einer anschließenden, fünfjährigen Facharztausbildung. Auch sie diagnostizieren und behandeln psychische Erkrankungen. Wenn dies notwendig ist, dürfen Psychiater:innen darüber hinaus Medikamente verschreiben. Arbeitsgebiete sind zum Beispiel die körperliche Diagnostik, Feststellung körperliche Ursachen einer psychischen Erkrankung, Zuführung einer geeigneten medizinischen Behandlung, Therapie, Rehabilitation von Menschen mit seelischen Erkrankungen, Forschung und Lehre.
Sind Klinische Psycholog:innen das gleiche wie Lebens- und Sozialberater:innen und Coaches?
Nein, es gibt grundliegende Unterschiede in der Ausbildung, Zulassung, Zielgruppe und den Arbeitsbereichen.
Klinische Psycholog:innen haben ein fünfjähriges Psychologie-Studium und eine umfangreiche postgraduelle Ausbildung absolviert. Der Begriff „Klinische Psycholog:in“ ist gesetzlich geschützt. Alle Klinischen Psycholog:innen müssen in die Berufsliste des Gesundheitsministeriums eingetragen sein.
Lebens- und Sozialberater:innen beraten (psychisch) gesunde Menschen, bei denen keine psychische Störung vorliegt. Sie dürfen keine Diagnosen stellen oder psychische Erkrankungen behandeln. Sollte im Rahmen einer Beratung der Verdacht auf eine psychische Erkrankung bestehen, ist die betroffene Person an eine:n Klinische:n Psycholog:in, Psychotherapeut:in oder Psychiater:in weiterzuverweisen. Der Lehrgang zum/zur Lebens- und Sozialberater:in dauert sechs Semester.
In Österreich ist die Berufsbezeichnung „Coach“ nicht geschützt. Demnach gibt es keine rechtlichen oder formalen Regelungen und theoretisch dürfte sich jede/r „Coach“ nennen. Unabhängig von der Bezeichnung dürfen aber selbstverständlich nur jene Inhalte und Methoden angeboten werden, für die eine entsprechende Ausbildung oder Qualifikation vorhanden ist. Tätigkeiten oder Methoden, die etwa in den Bereich der Klinischen Psychologie fallen, dürfen daher nur von entsprechend ausgebildeten Fachpersonen durchgeführt werden.
Gibt es Psycholog:innen, die nicht als Klinische Psycholog:innen arbeiten?
Ja, es gibt zahlreiche Psycholog:innen, die nicht als Klinische Psycholog:innen tätig sind. Beispielsweise können Psycholog:innen ohne klinisch-psychologische Ausbildung in folgenden Bereichen tätig sein:
- Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologie
- Verkehrspsychologie
- Umweltpsychologie
- Mediation
- Sportpsychologie
Auch für diese Tätigkeitsfelder ist jeweils eine entsprechende fachspezifische Ausbildung oder Weiterbildung erforderlich. Die Ausbildung richtet sich nach dem jeweiligen Schwerpunkt und kann – je nach Bereich, gesetzlich geregelt oder über anerkannte Zusatzausbildungen nachgewiesen werden.
Dürfen Klinische Psycholog:innen auch Medikamente verschreiben?
Nein, Klinische Psycholog:innen dürfen keine medikamentösen Therapien (beispielsweise Psychopharmaka) verschreiben. Dies ist Ärzt:innen, beispielsweise Psychiater:innen vorbehalten.
Ist klinisch-psychologische Behandlung und Psychologische Therapie eigentlich dasselbe?
Ja, die Begriffe klinisch-psychologische Behandlung und Psychologische Therapie werden synonym verwendet und bedeuten dasselbe.

Gesucht – Gefunden. Ihr Weg zur klinisch-psychologischen Behandlung
Wie vereinbare ich einen Termin bei Klinischen Psycholog:innen?
Termine bei Klinischen Psycholog:innen vereinbaren Sie ganz einfach direkt telefonisch oder via Email. Klinische Psycholog:innen in freier Praxis finden Sie zum Beispiel auf Psychnet, Österreichs größter Psycholog:innen-Suchmaschine psychnet.at oder Sie wenden sich an die Helpline des Berufsverbandes Österreichischer Psycholog:innen (Mo - Do 9.00 - 13.00 unter 01 504 8000 oder online via helpline@psychologiehilft.at).
Bei Klinischen Psycholog:innen, die in Ambulanzen, Krankenhäusern oder anderen Institutionen arbeiten, wenden Sie sich bitte direkt an die Einrichtung.
Wie finde ich passende Klinische Psycholog:innen? Auf was sollte ich achten?
Klinische Psycholog:innen finden Sie ganz leicht auf der Psycholog:innen-Suchmaschine Psychnet oder bei entsprechenden Einrichtungen. Gute erste Ansprechpersonen sind meist auch eigene Hausärzt:innen. Scheuen Sie sich nicht Angehörige/Freund:innen zu fragen, Sie bei der Suche zu unterstützen.
Bei der Suche nach passenden Klinischen Psycholog:innen achten Sie am besten auf:
- Qualifikation und Eintragung in die Liste des Gesundheitsministeriums als Klinische Psycholog:in
- Schwerpunkt und Spezialisierung
- Klinische Methoden und Behandlungssetting
- Erreichbarkeit und Ort
- Persönliche Passung – ein gutes Erstgespräch ist wichtig
- Wartezeit
Kann ich auch ohne Überweisung zu Klinischen Psycholog:innen gehen? Was gilt bei klinisch-psychologischer Diagnostik, klinisch-psychologischer Behandlung und klinisch-psychologischer Beratung?
Grundsätzlich ist es auch möglich ohne Überweisung zu klinischen Psycholog:innen zu gehen – es kommt darauf an, was Sie suchen und wie die Kosten abgedeckt werden sollen. Keine Überweisung ist nötig, wenn Sie Selbstzahler:in sind. Für die Behandlung/Therapie bei Klinischen Psycholog:innen (mit Kostenzuschuss) ist ebenfalls keine Überweisung nötig, jedoch spätestens vor Beginn der zweiten Einheit der klinisch-psychologischen Behandlung/Therapie eine ärztliche Bestätigung (von Allgemeinmediziner:innen oder Fachärzt:innen wie Neurolog:innen oder Psychiater:innen) zum Ausschluss körperlicher Ursachen vorzulegen. Ein vorheriger hausärztlicher Check-up zur Abklärung ist meist sinnvoll.
Weitere Infos hierzu finden Sie auch unter Informationen zum Kostenzuschuss BÖP
Bei einer klinisch-psychologischen Diagnostik benötigen Sie als Selbstzahler:in ebenfalls keine Überweisung. Um klinisch-psychologische Diagnostik auf Kosten der Krankenkasse zu erhalten, benötigen Sie eine ärztliche oder psychotherapeutische Zuweisung. Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen müssen in der Zuweisung eine Verdachtsdiagnose sowie eine präzise Fragestellung angeben.
Weitere Infos hierzu finden Sie auch unter Klinisch-psychologische Diagnostik BÖP
Für klinisch-psychologische Beratung ist grundsätzlich keine Überweisung nötig, da diese Kosten von Klient:innen selbst getragen werden müssen.
Kann ich nur mit einer diagnostizierten Störung zu Klinischen Psycholog:innen gehen?
Nein, Sie können auch ohne vorherige Diagnose zu Klinischen Psycholog:innen gehen.
Muss ich mich auf einen Termin bei Klinischen Psycholog:innen besonders vorbereiten?
Vorbereitungen sind keine Pflicht. Es kann aber hilfreich sein, wenn Sie sich freiwillig einige Gedanken zu Ihren Zielen, Symptomen und Beschwerden oder Ihren früheren Behandlungen, Ihrer Vorgeschichte oder besonderen Lebensereignissen machen und Ihre Fragen oder Anliegen an die oder den jeweiligen Psychologin/en sammeln. Schriftliche Vorbereitungen sind nicht nötig, auch ist es nicht schlimm, wenn Sie nicht Alles genau benennen können – dies ist Aufgabe der Klinischen Psycholog:innen.
Vom Erstkontakt zum erfolgreichen Abschluss – so läuft die klinisch-psychologische Behandlung ab
Wie läuft eine klinisch-psychologische Behandlung üblicherweise ab?
Üblicherweise läuft eine klinisch-psychologische Behandlung folgendermaßen ab:
- Erstgespräch mit Abklärung der Anliegen und umfassende Aufklärung über die Behandlung
- klinisch-psychologische Diagnostik und Störungs-, Problem- und Ressourcenanalyse
- gemeinsame Zielvereinbarung
- Gespräche, Übungen, Interventionen
- Alltagsintegration & Verlaufskontrolle
- Abschlussgespräch & Evaluierung
Was sind die Ziele einer klinisch-psychologischen Behandlung?
Ziele einer klinisch-psychologischen Behandlung lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Behandlung und Bewältigung psychischer Störungen
- Linderung und Beseitigung psychischer Beschwerden
- Unterstützung bei der Bewältigung von Belastungen und Krisen
- Verbesserung der Lebensqualität und des psychischen Wohlbefindens
Wie lange dauert eine klinisch-psychologische Behandlung?
Dauer und Frequenz einer klinisch-psychologischen Behandlung werden individuell abgestimmt, wobei eine regelmäßige Frequenz (beispielsweise einmal die Woche) empfohlen wird. Eine längere Behandlungsdauer hat sich als wirksamer erwiesen.
Was passiert beim ersten Termin bei Klinischen Psycholog:innen?
Beim ersten Termin geht es meistens darum, einen ersten Überblick über die aktuelle Situation zu bekommen, Vertrauen aufzubauen und erste Fragen zu klären sowie einen Plan für das weitere Vorgehen zu machen.
Bei einer klinisch-psychologischen Diagnostik erfolgt meist eine telefonische Erstinformation und beim ersten Termin eine Rahmenklärung bzgl. Anliegen, Auftrag, Ziel, verwendete Methoden und eine erste Anamnese (im Gespräch oder mithilfe eines Anamnesebogens) zu bisherigen Behandlungen/Untersuchungen, zu Ihrer Lebenssituation, dem Verlauf und Ihren aktuellen Beschwerden, Ihrem sozialen Umfeld u.v.m sowie Planung der weiteren Folgetermine. Ebenso kommen klinisch-psychologische Testverfahren zum Einsatz (meist bei Folgeterminen).
Genaue Informationen dazu finden Sie auch unter Klinisch-psychologische Diagnostik · BÖP
Was passiert, wenn ich das Gefühl habe, dass ich und mein/e Klinische/r Psycholog:in nicht gut zusammenarbeiten können?
Sie können das jederzeit mit der Klinischen Psychologin/dem Klinischen Psychologen besprechen und gemeinsam eine Lösung finden. Sie können auch zu einer/m anderen Klinischen Psychologin/en wechseln.
Die Beziehung zwischen Klient:in und Behandler:in ist ein wichtiger Faktor für die Wirksamkeit der Behandlung und Sie sollten innerhalb der ersten Sitzungen darauf achten, dass Sie sich wohl fühlen und mit der/dem Klinischen Psycholog:in zusammenarbeiten können.
Bieten Klinische Psycholog:innen auch Online-Termine an?
Ja, manche Klinische Psycholog:innen bieten auch Online-Termine an. Dies ist im Vornherein mit den Klinischen Psycholog:innen zu besprechen und zu klären, ob dieses bestimmte Setting geeignet ist.
Vom Trauma bis Schmerz – Wie Klinische Psycholog:innen bei speziellen Anliegen helfen:
Gibt es auch Klinische Psycholog:innen speziell für ein Thema wie zum Beispiel Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie?
Ja, es gibt Spezialisierungen. Diese sind: Gerontopsychologie, Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie, Klinische Neuropsychologie, Notfallpsychologie und Schmerzpsychologie. Erworben werden können diese, wenn Klinische Psycholog:innen in diesem Bereich mindestens fünf Jahre praktisch tätig waren und eine bestimmte Anzahl von Fortbildungen absolviert haben. Dann ist auch eine offizielle Eintragung der jeweiligen Spezialisierung in die Liste des Gesundheitsministeriums möglich.
Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche Weiterbildungen wie Biofeedbacktherapie etc. Ob Klinische Psycholog:innen über entsprechende Spezialisierungen und Weiterbildungen verfügen, können Sie beispielsweise auf der Psycholog:innen Suchmaschine Psychnet einsehen.
Ich habe eine schwere körperliche Erkrankung, einen Unfall erlebt oder andere körperliche Probleme (Schmerzen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme, Mehrgewicht, Magen-Darm-Probleme etc.) – können dabei auch Klinische Psycholog:innen helfen?
Ja, Klinische Psycholog:innen können – ergänzend zu einer ärztlichen Behandlung - auch bei körperlichen Erkrankungen, chronischen Schmerzen oder psychosomatischen Beschwerden und nach Unfällen, Traumata oder belastenden Erfahrungen unterstützen.
Bei chronischen Schmerzen können Klinische Psycholog:innen mit etablierten Behandlungsmethoden wie Schmerzkontrolltraining, Biofeedback, kognitive Therapie u.s.w. dabei helfen, einen Umgang mit Schmerzen zu finden. Ebenso unterstützen Klinische PsychologInnen auch Betroffene sowie Angehörige im Bereich der Psychodiabetologie – zum Beispiel durch die Förderung der Akzeptanz der Erkrankung, Selbstmanagement und Unterstützung bei der Integration in den Alltag oder bei der Reduktion diabetesbezogener Ängste etc.
Zahlreiche weitere Informationen zu den Einsatzgebieten und bei welchen Anliegen Klinische Psycholog:innen noch helfen können, finden Sie auch in unseren Foldern unter Folder · BÖP. Diese können Sie sich auch zu sich nach Hause schicken lassen.
Behandeln Klinische Psycholog:innen nur psychische Störungen oder sind sie auch Ansprechpersonen in schweren Lebensphasen, Beziehungskrisen oder stressigen Zeiten?
Klinische Psycholog:innen sind auch Ansprechpersonen, wenn man sich psychisch belastet fühlt, Entlastung oder Orientierung sucht oder eine Lebenskrise, einen Verlust oder eine Trennung verarbeiten muss, Beziehungsprobleme, familiäre Konflikte oder Schwierigkeiten im sozialen Umfeld erlebt sowie unter Stress, Burnout, Erschöpfung oder Überforderung leidet.
Ich möchte mich gerne persönlich weiterentwickeln und belastende Probleme aus meiner Vergangenheit aufarbeiten, kann ich dafür auch zu Klinischen Psycholog:innen gehen?
Natürlich. Sie können auch zu Klinischen Psycholog:innen gehen, wenn Sie Ihre psychische Gesundheit stärken oder sich persönlich weiterentwickeln möchten oder sich mit Identitätsfragen, Selbstwertproblemen oder Emotionsregulation beschäftigen.
Kann ich auch mit meinem Partner/meiner Partnerin, meiner Familie oder anderen Angehörigen zusammen zu Klinischen Psycholog:innen gehen?
Klinische Psycholog:innen bieten auch sogenannte Familien- oder Paargespräche an. Besprechen Sie das am besten direkt mit der jeweiligen Klinischen Psychologin oder dem jeweiligen Klinischen Psychologen.
Kann ich auch zu Klinischen Psycholog:innen gehen, wenn ein/e Angehörige/r Probleme hat und ich damit nicht umgehen kann oder diese/n unterstützen möchte, aber nicht weiß, wie?
Sie können sich im Rahmen einer klinisch-psychologischen Beratung oder auch Behandlung Wissen und Rat im Umgang oder bei Problemen mit Familie, Angehörigen oder anderen sozialen Kontakten einholen.
Gibt es auch Gruppenangebote?
Ja, es gibt auch Gruppenangebote. Diese können in unterschiedlichen Kontexten stattfinden, also ambulant, stationär oder sogar online. Mögliche Angebote und Inhalte können dabei Achtsamkeitstrainings, Entspannungs- oder Atemtechniken sein, aber auch Psychoedukation oder das Training sozialer und emotionaler Kompetenzen. Diese Gruppenangebote können störungs- oder zielgruppenspezifisch sein, wie zum Beispiel Angehörigengruppen, Trauergruppen oder Gruppen für Kinder und Jugendliche mit Neurodiversität u.s.w. Diese Gruppenangebote werden dabei stets von einem oder mehreren Klinischen Psycholog:innen geleitet und haben unterschiedliche Dauer, Teilnehmer:innenanzahl und Kosten.
Gibt es auch körperorientierte Angebote (Biofeedback, Neurofeedback, etc.)?
Ja, es gibt auch körperorientierte Interventionen in der klinisch-psychologischen Behandlung und Beratung, wie zum Beispiel Embodiment, neuroaffektive und bewegte Meditationen, aber auch Biofeedback und Neurofeedback u.v.m. Klinische Psycholog:innen mit entsprechender Zusatzausbildung dürfen z.B. im Rahmen der klinisch-psychologischen Behandlung und Beratung Biofeedback Verfahren anwenden. Es handelt sich dabei um ein Verfahren, bei dem bestimmte Körperfunktionen wie Atmung, Herzfrequenz, Muskelspannung oder Durchblutung, mithilfe technischer Sensoren sichtbar und hörbar rückgemeldet werden („Feedback“). Das Verfahren ist nicht invasiv und dient ausschließlich der Rückmeldung und Bewusstmachung physiologischer Prozesse. Ziel ist es, die Wahrnehmung und Selbstregulation dieser physiologischen Prozesse zu fördern. Klient:innen lernen dadurch körperliche Reaktionen besser zu verstehen und bewusst zu beeinflussen, um Stress zu reduzieren oder mit körperlichen Beschwerden besser umgehen zu können. Das Verfahren wird dabei nicht zu diagnostischen oder medizinischen Zwecken eingesetzt, sondern ausschließlich als psychologische Interventionsmethode im Sinn der Förderung von Selbstkontrolle, Entspannung, Stressbewältigung etc.
Wann muss ich zu Klinischen Psycholog:innen gehen und wann reicht auch eine App oder ein Online-Kurs zu mentaler Gesundheit?
Klinische Psycholog:innen sind Expert:innen für mentale Gesundheit. Apps und Online-Kurse zu mentaler Gesundheit können eine gute Ergänzung zur Behandlung bei Klinischen Psycholog:innen oder eine Möglichkeit sein, sich selbst zu reflektieren und/oder sich selbstständig zur mentalen Gesundheit zu informieren oder weiterzubilden. Anders als bei Apps oder Online-Kursen erfolgt bei Klinischen Psycholog:innen die klinisch-psychologische Behandlung und Beratung individuell, personalisiert und indikationsorientiert.
Gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, rechtliche Regelungen und Leitlinien?
Ja. Das Psychologengesetz 2023 regelt die beruflichen Rechte und Pflichten von Klinischen Psycholog:innen in Österreich. Dazu gehören insbesondere:
- Verschwiegenheitspflicht: Klinische Psycholog:innen und deren Hilfspersonen sind zur Wahrung der Verschwiegenheit über alle ihnen in der Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet.
- Aufklärungspflicht: Klient:innen müssen vor der Erbringung von klinisch-psychologischen Leistungen insbesondere über Ziel, Art, Umfang und mögliche Folgen der psychologischen Tätigkeit in verständlicher Weise informiert werden. Lassen Sie sich im Erstgespräch über Ihre Rechte und den Ablauf der Behandlung/Beratung/Diagnostik umfassend informieren.
- Pflicht zur Berufsausübung nach Besten Wissen und Gewissen: Psychologische Leistungen sind nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft auszuüben.
- Dokumentationspflicht: Klinische Psycholog:innen sind verpflichtet über durchgeführte Maßnahmen eine fachgerechte und nachvollziehbare Dokumentation vertraulich zu führen und diese für die gesetzliche vorgesehenen Aufbewahrungsdauer sicher aufzubewahren.
- Einsichts- und Auskunftsrecht: Klinische Psycholog:innen müssen ihren Klient:innen über Verlangen alle Auskünfte über ihre Leistungen erteilen. Gesetzlichen Vertreter:innen der Klient:innen sind insofern Auskünfte über die von ihnen gesetzten klinisch-psychologischen Maßnahme zu erteilen, als diese das Vertrauensverhältnis zu den Klient:innen nicht gefährdet. Die Auskunft an gesetzliche Vertreter:innen ist auf die Rahmendaten (Entgelt, Dauer, Frequenz, Grund) zu beschränken. Klient:innen und deren gesetzlichen Vertreter:innen sind unter besonderer Bedachtnahme auf die therapeutische Beziehung auf Verlangen alle Auskünfte über die geführte Dokumentation sowie Einsicht in die Dokumentation zu gewähren oder die Herstellung von Abschriften zu ermöglichen, soweit diese das Vertrauensverhältnis zu den Klient:innen nicht gefährden. Die Auskunft an gesetzliche Vertreter:innen ist auf die Rahmendaten (Entgelt, Dauer, Frequenz, Grund) zu beschränken.
Neben dem Psychologengesetz 2013 gelten für die Berufsausübung auch zahlreiche Richtlinie des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Diese konkretisieren die gesetzlichen Bestimmungen und dienen insbesondere der Qualitätssicherung, dem Schutz von Klient:innen und der Einhaltung ethischer Standards.
Wird das, was man sagt auch wirklich vertraulich behandelt? Können Familienangehörige oder Lebenspartner:innen von dem, was ich sage, erfahren?
Alles, was Sie im Rahmen der klinisch-psychologischen Behandlung oder Beratung sagen, unterliegt der Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, dass alles, was Sie sagen an keine Dritte weitergegeben werden darf (wie z.B.: Freund:innen, Familienangehörige oder Partner:innen).
Eine Weitergabe von Informationen ist nur in gesetzlich ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen erlaubt. Etwa in Bezug auf das Auskunftsrecht von gesetzlichen Vertreter:innen (jedoch beschränkt auf die Rahmendaten), bei gesetzlichen Anzeigepflichten, im Fall einer Kindeswohlgefährdung oder bei akuter Selbst -oder Fremdgefährdung. In solchen Fällen werden Sie – soweit es die Situation zulässt bzw. gesetzlich zulässig ist – vorab informiert, jedenfalls aber im Rahmen der Aufklärung über die bestehenden Rechte und Grenzen der Verschwiegenheitspflicht aufgeklärt.
Das liebe Geld – so wird klinisch-psychologische Behandlung finanziert
Muss ich klinisch-psychologische Behandlung bei Klinischen Psycholog:innen immer selbst zahlen? Gibt es eine finanzielle Unterstützung?
Sie müssen klinisch-psychologische Behandlungen bei Klinischen Psycholog:innen nicht immer vollständig selbst bezahlen. Seit dem 1. Jänner 2024 gibt es die Möglichkeit, bei den für sie zuständigen österreichischen Sozialversicherungsträgern (z.B. ÖGK, BVAEB; SVS) einen Kostenzuschuss zur klinisch-psychologischen Behandlung zu beantragen. Die Höhe kann je nach Versicherungsträger variieren.
Ebenso hilft die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in besonderen Notlagen im Zusammenhang mit Gesundheitskosten und bietet deshalb freiwillige Zuschüsse aus dem Unterstützungsfonds an. Für klinisch-psychologische Behandlung kann ein Antrag für einen Zuschuss gestellt werden. Alle Informationen dazu finden Sie hier:https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.870473
Muss ich klinisch-psychologische Diagnostik bei Klinischen Psycholog:innen immer selbst zahlen?
Klinisch-psychologische Diagnostik ist seit dem 1994 eine Leistung, die in bestimmten Fällen von den Krankenkassen übernommen werden kann. Das heißt, diese Leistung ist direkt mit den Krankenkassen zu verrechnen. Klient:innen benötigen für eine klinisch-psychologische Diagnostik eine Überweisung ihres Arztes bzw. ihrer Ärztin oder ihres Psychotherapeuten bzw. ihrer Psychotherapeutin. Wenn Sie eine klinisch-psychologische Diagnostik bei Wahlpsycholog:innen in Anspruch nehmen wollen oder genommen haben, bekommen Sie 80% des Betrags, den Vertragspsycholog:innen erhalten würden, von Ihrer Krankenkasse rückfundiert. Für die Kostenerstattung benötigen Sie die Zuweisung sowie eine detaillierte, saldierte Honorarnote mit folgenden Angaben:
- Art und Dauer der durchgeführten Tests (Intelligenz-, Persönlichkeits-, Leistungstests, etc.)
- Diagnose
- Stempel der/des Leistungserbringer:in/s
- Behandlungsdatum
Wie funktioniert der Kostenzuschuss bei klinisch-psychologischer Behandlung?
Seit 2024 ist klinisch-psychologische Behandlung im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) der Krankenbehandlung gleichgestellt. Alle Versicherten können erstmals von ihrer Sozialversicherung einen Kostenzuschuss für klinisch-psychologische Behandlung beantragen. Dieser Kostenzuschuss variiert je nach Sozialversicherungsträger im Jahr 2025 zwischen 33,70 Euro und 46,60 Euro.
Als BÖP haben wir eine eigene Informationsseite eingerichtet, wo wir alle wichtigen Fragen zum Kostenzuschuss beantworten. Hier finden Sie alle Informationen zum Kostenzuschuss: https://www.boep.or.at/psychologische-behandlung/asvg-informationen
Muss ich bei einem Behandler:innenwechsel erneut eine ärztliche Bestätigung vorweisen?
Das kommt ganz darauf an, in welchem Zeitraum Sie wechseln wollen und bei welcher Krankenkasse Sie versichert sind. Fragen Sie am besten direkt bei Ihrer Krankenkasse nach!
Weitere Informationen
Klinische Psycholog:innen in Ihrer Nähe finden Sie auf Österreichs größter Psycholog:innen-Suchmaschine Psychnet. Zu Psychnet.
Bei Fragen zum Thema Psychologie oder wenn Sie mit einer/m Psycholog:in sprechen möchten: Unsere Helpline ist für Sie da. Montag bis Donnerstag 9 bis 13.00 Uhr kostenlos und vertraulich unter: 01 504 8000, helpline@psychologiehilft.at
Informationen zum Kostenzuschuss finden Sie hier.
Weitere Informationen finden Sie in unseren zahlreichen Foldern. Zu den BÖP-Foldern.