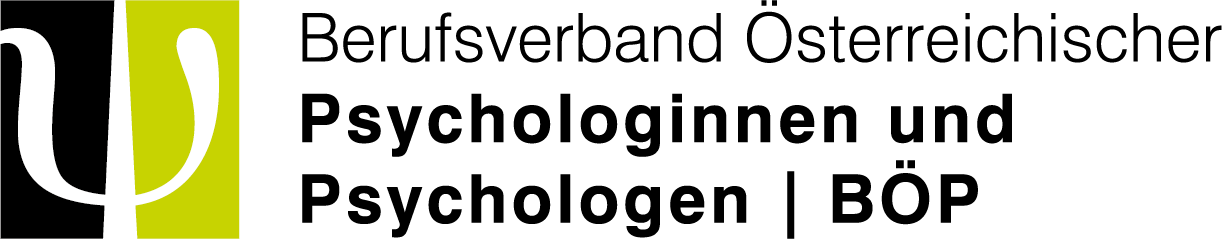Gesundheitspsychologie-Plattform
multiSENSE: Wie gefährlich kann Hitze sein?
Beschreibung: Durch die Klimaerwärmung nimmt die Anzahl sowie die Intensität von Hitzewellen im Sommer kontinuierlich zu – ein Trend, der sich laut Prognosen in den kommenden Jahren weiter verstärken wird. Extreme Hitze hat erhebliche gesundheitliche Folgen, von denen insbesondere vulnerable Gruppen wie ältere Menschen, Frauen und Personen mit Vorerkrankungen betroffen sind. Zahlreiche Studien belegen, dass in diesen Gruppen sowohl Morbidität als auch Mortalität mit steigender Hitze deutlich zunehmen. Ein wesentlicher Erklärungsansatz liegt in der eingeschränkten thermoregulatorischen Anpassungsfähigkeit älterer Personen: Physiologische Abkühlungsmechanismen wie Schwitzen oder die Erhöhung der Herzfrequenz sind bei ihnen bis zu 50 % weniger wirksam. Hinzu kommt, dass die subjektive Wahrnehmung von Hitze nicht immer der tatsächlichen Bedrohung entspricht. Dadurch entsteht ein komplexes Zusammenspiel psychophysiologischer Risikofaktoren, das die Gefährdung älterer Menschen zusätzlich erhöht. Bisherige Untersuchungen basieren jedoch überwiegend auf Laborstudien mit gesunden, zumeist jungen Proband:innen. Um die Prozesse unter realen Bedingungen besser zu verstehen, führen wir eine ambulante EKG-Studie mit Pflegeheimbewohner:innen unter natürlicher Hitzeexposition durch und erfassen zugleich in Interviews die Erfahrungen, Einstellungen und Glaubenssätze von Bewohner:innen und Pflegepersonal. Auf diese Weise gewinnen wir ein ganzheitliches Bild der hitzespezifischen Gesundheitsrisiken in Pflegeheimen. Die EKG-Studie richtet sich an Bewohner:innen von Pflegeheimen (männlich und weiblich), die in der Lage sind, eine informierte Einwilligung zu geben. Personen mit fortgeschrittener dementieller Erkrankung oder unter Erwachsenenvertretung, die nicht einwilligungsfähig sind, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Die geplante Stichprobengröße umfasst 70 Bewohner:innen. Für die qualitativen Interviews umfasst die Zielgruppe sowohl Bewohner:innen als auch das Pflegepersonal der beteiligten Pflegeheime.
Ziel des Projekts ist es, die psychophysiologische Belastung durch extreme Hitze bei Pflegeheimbewohner:innen systematisch zu erfassen. Ergänzend sollen Einstellungen, Erfahrungen und Meinungen von Bewohner:innen und Pflegepersonal in Bezug auf Klimawandel und Hitzewellen erhoben werden – mit besonderem Fokus auf die Frage, wie es ist, während extremer Hitze in einem Pflegeheim zu leben (Bewohner:innen) bzw. zu arbeiten (Personal).
Im Rahmen der EKG-Studie erfolgt zunächst ein Screening zur Überprüfung der Ein- und Ausschlusskriterien der teilnehmenden Bewohner:innen. Anschließend tragen die Proband:innen tagsüber jeweils an zwei Messzeitpunkten über fünf Tage hinweg ein mobiles EKG-Gerät: einmal während einer Hitzewelle (≥ 28 °C) und einmal bei neutralen Temperaturen (ca. 20 °C). Ergänzend wird einmal täglich in einem kurzen Gespräch mit Projektmitarbeiter:innen die subjektive Wahrnehmung erfasst, beispielsweise Stimmung, Wohlbefinden und Belastung.
Parallel dazu werden qualitative Interviews mit Bewohner:innen und Pflegepersonal durchgeführt. Diese dauern jeweils rund 20 Minuten und thematisieren Erfahrungen und Einstellungen zu Klimawandel, Hitzewellen, eingesetzten Abkühlungsstrategien und deren Effektivität sowie das Digitalisierungspotenzial im Umgang mit Hitze. Die Interviews werden mit Zustimmung der Teilnehmenden per Audio aufgenommen.
Webseite: https://www.dilt.at/projekte/multisense
Laufzeit: 2024-2026
Bisherige Erfolge: Bisher konnten fünf Pflegeheime in der Steiermark und in Wien als Praxispartner gewonnen werden. Insgesamt wurden 47 Bewohner:innen erfolgreich rekrutiert, die bereits die Messungen in der Hitze-Bedingung abgeschlossen haben. Derzeit läuft bei denselben Teilnehmer:innen die Datenerhebung in der neutralen Temperaturbedingung. Darüber hinaus wurden bislang 21 qualitative Interviews mit Bewohner:innen und Pflegepersonal durchgeführt.
Einreichende Organisation/ Person: Katja Ceplak, BSc MSc, Universität Graz, Institut für Psychologie, AB Gesundheitspsychologie
Gesundheitspsychologie-Plattform